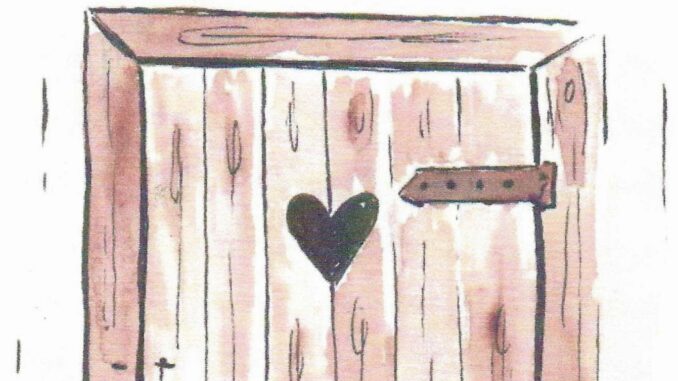
Bei uns auf dem Land im kleinen Dorf mit vielen Katen und Bauernhäusern gab es damals noch keine Kanalisation und auch keine Wasserleitung. Die Häuser hatten einen Brunnen, den sogenannten „Soot“, der ja auch in einem plattdeutschen Lied so gut besungen wird. Da war die Pumpe, mit der man per Hand das Wasser heraufpumpen musste.
Bei uns im Kuhstall stand ein Druckkessel, mit dessen Hilfe das Wasser fürs Vieh bis in den Stall gepumpt werden konnte. In trockenen Jahren, und ich erinnere mich sehr gut daran, waren die Brunnen manchmal leer und das benötigte Wasser konnte in der Meierei, die ja einen Tiefenbrunnen besaß, per Wasserwagen herangeholt werden. Dieser Wasserwagen wurde auch für das Jauche-Ausbringen aufs Feld benutzt. So war das nun mal. Aber sicher wurde er dafür gründlich gereinigt. Es war aber nie von Wasserknappheit die Rede; man musste es dann nur holen.
Badezimmer und die heute unverzichtbaren Spültoiletten hat es bis zu den späten 60er Jahren bei uns nicht gegeben. Als dann endlich eine Wasserleitung bei uns durch den Wald und durch den Garten bis zu unserer kleinen Kate verlegt wurde, mussten ein paar sehr alte große Apfelbäume weichen. Bis es aber mit dem fließend Wasser aus dem Hahn endlich so weit war, behalf man sich, weil man kein Waschbecken hatte mit Waschschüsseln, die man aus dem Wassereimer füllte. Die Waschschüssel stand bei uns auf einem Hocker bereit; ein Handtuch hing an einem Haken daneben. Und ein Stück Seife lag natürlich auch dabei. Auf einem anderen Hocker stand ein voller Wassereimer, und mit einem Litermaß, das daran hing, konnte man sich bei Durst bedienen oder die Waschschüssel mit sauberem Wasser füllen. Der Küchentisch besaß unter seiner Tischplatte noch eine zweite Platte mit zwei großen Emailleschüsseln darin. Nach den Mahlzeiten zog man diese Vorrichtung hervor und goss das heiße Wasser vom Kessel auf dem Herd in eine Schüssel. So ging der Abwasch vonstatten. Wobei wir Kinder immer abzutrocknen hatten. Davor habe ich mich gerne gedrückt, aber meine Oma war auch oft so nett, diese Arbeit für mich zu übernehmen. „Dat mak ik, ga du man rut!“ Der Opa hat auch abgetrocknet, wenn er nichts anderes zu tun hatte.
Von der Küche aus ging es durch den „Düster Gang“ (ein fensterloser Durchgangsraum in einer kleinen Bauernkate) in die Loh und zum Stall. An der Wand befanden sich diverse Haken. Dort wurde die Melk- und Arbeitskleidung aufgehängt; auch Gummistiefel, Arbeitsschuhe und Klotzen (Holzschuhe) hatten dort ihren Platz. Natürlich roch es da drinnen nicht gut. Die Ausdünstungen der Arbeitsbekleidungen blieben nach Benutzung in dem Raum hängen, denn ein Fenster zum Öffnen gab es nicht, und die Tür zur Küche wurde immer geschlossen. Wohl wegen der Mäuse. In diesem Düstergang versteckte ich mich oft, um meine Oma zu erschrecken. Diese erschrak immer sehr (mir zum Gefallen), und dann lachten wir beide.
Nachdem die Wasserleitung endlich gelegt worden war, wurde die Schüssel auf dem Hocker durch ein Waschbecken ersetzt, nur für kaltes Wasser, aber was für ein Luxus! Ein Badezimmer gab es immer noch nicht. Auch keine Waschmaschine oder Spültoilette. Neben dem Hühnerstall befand sich die Waschküche mit dem großen Waschkessel. Der musste mit Holz angeheizt werden. Mehrere Zinkwannen standen dort, große und kleine, fürs Baden (einmal in der Woche) und wenn sonst viel heißes Wasser gebraucht wurde, zum Beispiel fürs Schlachten. Im Sommer stellte man die Wannen nach draußen, wo wir Kinder so richtig drin herumplanschen durften.
Das Wäschewaschen bedeutete sehr viele und harte Arbeit für die Frauen auf dem Land. Besonders im Winter. Bei den „größeren“ Bauern kam dann meist alle 14 Tage eine Waschfrau ins Haus, die dabei half. Alt und Jung wohnten oft zusammen, hatten eine gemeinsame Küche, so wie bei uns zu Hause. Also wurde auch die Wäsche gemeinsam erledigt. Ich sehe noch vor mir, wie meine Mutter und Großmutter die großen Wäschestücke per Hand spülten, auswrangen und über die Leine bugsierten, wo diese dann im Winter steif gefroren hingen.
Unser Plumpsklo hinter der Scheune war ein richtiges kleines Häuschen, zum Glück nicht mit einem Eimer darunter, wie bei vielen anderen Leuten. Ich möchte hier lieber nicht beschreiben, was es da für Unterschiede gab. So mancher, der sich mit Plumpsklos noch auskennt, wird wohl wissen, was ich damit meine. Mein Opa und mein Vater hatten eine richtig tiefe Grube ausgehoben. Ab und zu wurde dessen Inhalt auf den Misthaufen gefahren,
Weil der Weg zum Klo nachts doch etwas umständlich war, benutzte man für die „kleinen Geschäfte“ den Nachttopf, der früher überall in den Schlafzimmern unterm Bett stand. Den Nachttopf meiner Mutter (aus Porzellan) benutze ich heute für Kleinigkeiten auf meinem Schreibtisch, wie Stifte und Klebezettel. Ich habe ihn auch schon mal als Blumenübertopf verwendet.
1966 habe ich eine Zeitlang in einem landwirtschaftlichen Fuhrgeschäftshaushalt gearbeitet. Dort gab es tatsächlich gleich neben deren Küche, sozusagen im Windfang, das Plumpsklo. Es war ein Vier-Generationen-Haushalt. Natürlich wurde dort in der sehr großen Küche zusammen gegessen. Der Herd stand mitten im Raum; man konnte um ihn herumgehen. Sehr praktisch, fast wie heutzutage in den ganz modernen Küchen, nur eben mit Feuer zu beheizen. Es war auch ein großer Beikessel im Herd vorhanden für reichlich heißes Wasser. Dort habe ich das Kochen auf einem Feuerherd gelernt. Die schon sehr alte und Respekt einflößende Großmutter verstand sich mit ihrer Schwiegertochter (meiner Chefin) nicht sehr gut. Aber verständlich, weil die Uroma sich überall einmischte und immer noch das Sagen haben wollte. Dann gab es das junge Ehepaar, und deren kleinen Sohn. Diese hatten sozusagen gar nichts zu sagen. Sie kamen mit an den Tisch und verschwanden wieder bis zur nächsten Mahlzeit. Gleich nach dem Essen stand die Großmutter oft auf, um aufs Klo zu gehen. Das mochte meine Chefin gar nicht leiden. Sie gab dann sehr schnippisch folgenden Kommentar: „Na so as jümmer! Mut dat sien? Vun de Disch na de Wisch!“ Ihr Mann, also der Sohn der Alten, stand dann auch auf, kommentarlos, und die Mahlzeit war aufgehoben. Dieser Konflikt zwischen den Generationen ging so weit, dass ich die gesammelten Eier aus dem Hühnerstall sofort in den Keller bringen sollte, damit die Uroma nicht nachzählen konnte, wie viele Eier gelegt worden waren. Das Zusammenleben von Alt und Jung war zu allen Zeiten nicht nur von Harmonie geprägt. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich habe dort aber sehr viel gelernt und bin gerne dort gewesen.
Der Plumpsklo-Eimer wurde regelmäßig von einem alten Herrn geleert, der nach getaner Arbeit immer sofort in die Küche kam und seinen Lohn abholte, ein Glas Cognac. Ich habe diese „Duftmischung“ noch in der Nase, wenn ich daran denke und mag bis heute keinen Cognac.
Bei uns zu Hause wurde 1967 endlich (im Stall) ein Badezimmer eingebaut. Woanders war dafür kein Platz vorhanden. Meine Großmutter weigerte sich, die Spültoilette zu benutzen; sie war ihr unheimlich. Das hat an ihrer zunehmenden Demenz gelegen. Sie ging also weiterhin „na Tante Meier“. Als es mit dem Laufen schwieriger für sie wurde, hat mein Opa ihr aus einem alten Lehnstuhl einen Toilettenstuhl gebaut. So einen oder ähnlichen habe ich dann viel später während meiner Dienstzeit in vielen Haushalten auf Bauernhöfen vorgefunden. Die ersten „modernen“ Toilettenstühle. Unser altes Klo wurde irgendwann zu einem Kaninchenstall umgebaut, bevor es endgültig verschwand.
Ich weiß die heutigen Vorteile in der Hygiene sehr zu schätzen. Entbehrt habe ich aber nichts; wenn man es nicht anders kennt, dann ist es normal. Vielleicht waren wir dadurch etwas abgehärteter.
Was ich mir (im Nachhinein) gewünscht hätte, wäre eine bessere Zahnpflege. Die gab es für die Kinder und auch für die Erwachsenen nicht so wie heute. Aber dafür werden so unendlich viele Süßigkeiten angeboten, und das kann auch nicht gut sein. Alles hat eben, wie schon gesagt, seine Vor- und Nachteile. Jetzt ist es schon so, dass nicht jeden Tag geduscht oder gebadet werden sollte, um das kostbare und auch teurer gewordene Wasser zu sparen. Das sei jedem selbst überlassen, wie er damit umgeht. Das Wasser läuft aus dem Wasserhahn und wird zum Teil wirklich verschwendet, und von den Meiereien kann man es sich nicht mehr holen.
Herta Andresen